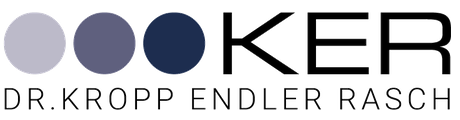Rechtsanwalt Dr. Hans-Thomas Kropp, Fachanwalt für Agrarrecht und Dipl.-Ing. für Tierproduktion (FH)
Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrter Herr Menger,
sehr verehrte Gäste,
Corona bedingt fallen die so bestimmenden Jubiläen des Jahres 2020 zusammen, die wir heute mit dem 60. Jahrestag des „Sozialistischen Frühlings“ in der ehemaligen DDR und der 30. Wiederkehr der Herstellung der Deutschen Einheit begehen. Eine bemerkenswerte zeitliche Konstellation, die mich dennoch nachdenklich macht, da man wohl nur auf einen ersten Blick meinen könnte, die Bewältigung der Folgen der Kollektivierung der ostdeutschen Landwirtschaft, die im „Sozialistischen Frühling“ ihren Höhepunkt und seinerzeitigen Abschluss fand, hätte im Maßstab der deutschen Historie mit der Wiedervereinigung eine Art „Happy End“ genommen.
Denn so einfach ist ein solcher Kontext schon aus zeitlicher Betrachtung nicht.
Eine sowohl gesellschafts-, agrar- aber auch rechtshistorische Konstellation, die eine anspruchsvolle Ausgangsposition für meine Festrede zu dieser Feierstunde beinhaltet.
Das ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich, zumal die Aufgabenstellung von Ihrem Präsidenten Herrn Klamroth als einer Persönlichkeit aufgerufen wurde, die wie kaum eine zweite nach 1990 für die Wiederherstellung solcher agrarstrukturellen Verhältnisse gekämpft hat, die – und da schließt sich der Kreis – im Osten Deutschland durch den „Sozialistischen Frühling“ zwar nicht für immer zerstört wurden, der aber für einen historisch relevanten Zeitraum von immerhin mehreren Jahrzehnten viele Bauern den Großteil ihres Arbeitslebens an der freiheitlichen Gestaltung ihrer Produktivkräfte entscheidend behinderte. Viele dieser Landwirte haben – auch das haben wir heute zu bedenken – das „Happy End“ der Jahre 1989/90 leider nicht mehr erleben können.
Wenn ich im Übrigen daran erinnert werde, wer der Festredner zur Feierstunde des 50. Jahrestages des „Sozialistischen Frühlings“ war, nämlich Herr Prof. Böhmer, bewege ich mich zweifellos in großen Spuren, wobei ich diese Konstellation – damals der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, heute ein bescheidener Agrarjurist, Jahrgang 1960 – durchaus als Herausforderung empfinde. Dennoch kann insoweit keine „Gleichwertigkeit“ im „Prominenzfaktor“ bestehen, sie ist wohl so auch nicht angestrebt.
Darum – und das hatte mir Ihr Präsident auch so offeriert – will ich in Kenntnis der Inhalte der damaligen Festrede von Herrn Prof. Böhmer heute einen anderen thematischen Ansatz finden, der vor allem meine beruflichen (d.h. juristischen) Erfahrungen zu den rechtlichen Hintergründen des „Sozialistischen Frühling“ und den Abläufen nach 1990 bei der Reprivatisierung der ostdeutschen Landwirtschaft widerspiegelt. Letzteres, d.h. die Folgen bzw. die Umsetzung der Privatisierung beschäftigt uns bis in die Gegenwart, zwar heute weniger aus rechtlicher, aber immer noch aus betriebswirtschaftlicher und vor allem agrarstruktureller Sicht.
Aber zunächst – vor allem für die Jüngeren unter uns – eine kurze historische Reminiszens.
1.
Der „Sozialistische Frühling“ mit seiner Folge der umfassenden Kollektivierung der ostdeutschen Landwirtschaft reihte sich unter den marxistisch-leninistischen Entwicklungstheorien der Vergesellschaftung der Produktionsmittel in der Landwirtschaft nahtlos in die vorherigen Eingriffe durch die sogenannte „Demokratische Bodenreform“ mit ihren Enteignungen allen Grundeigentums in einer Hand von über 100 ha und der sogenannten „Kriegsschuldigen“, ebenso ein, wie die zielgerichtete Vertreibung unliebsamer Landwirte bis Mitte der 50er Jahre (Stichworte: „Großbauern“ mit Besitz über 20 ha, Betriebsdevastierungen, Abrechnungsgrundlagen der „Freien Spitzen“).
Fraglos war die staatlich massiv gelenkte Gestaltungsaktion der Herstellung der Vollgenossenschaftlichkeit im Rahmen des „Sozialistischen Frühlings“ nicht das Ergebnis freier bzw. unbeeinflusster Willensbildungsprozesse der bis zum Ende der 50er Jahre freien Bauern, sondern Resultat des Umstandes, dass die bis dahin unter relativer Freiwilligkeit gelenkte Bewegung zum Eintritt in die bereits seit etwa 1952 existierenden LPGen weit hinter den Erwartungen der Partei und Staatsführung zurückblieb. Nach damaliger Statistik war im Jahr 1959 ein Stand erreicht, bei dem durch die bestehenden LPGen nur ein bescheidene Anteil von 23,2 % der LN in der DDR bewirtschaftet wurde.
Erlebnisberichte teils erschütternder Natur betroffener Bauernfamilien, die dazu führten, dass durch permanenten Druck Betriebsinhaber flüchteten, ins Gefängnis gesperrt wurden oder gar Suizid begingen, geben nachhaltigen Anlass zu unserem heutigen Gedenken. Viele der heute Erschienen werden das aus erster Hand bzw. aus der jeweiligen Familienhistorie beeindruckender schildern können, als ich. Obwohl der damalige Zeitabschnitt bestimmendes Thema innerhalb meiner Promotion war und ich dazu auch umfassend geforscht habe, läge eine Wiedergabe entsprechender Erlebnisberichte bei mir jedenfalls im Zusammenhang mit meinem heutigen Festbeitrag nicht in den bestmöglichen Händen. Ich beschränke mich daher zum „Sozialistischen Frühling“ auf eine Würdigung aus vor allem rechtshistorischer Sicht.
Zunächst verging sich die Nomenklatura in der DDR mit dem unter enormen Zwang der in 1959/1960 durchgeführten Aktionen teilweise an den eigenen „Klassikern“, hier am Beispiel eines Zitates von F. Engels.
„Unsere Aufgabe gegenüber dem Kleinbauern besteht zunächst darin, seinen Privatbetrieb und Privatbesitz in einen genossenschaftlichen überzuleiten, nicht mit Gewalt, sondern durch Beispiel und Darbietung gesellschaftlicher Hilfe zu diesem Zweck …“
Dass die Nomenklatura solche Leitsätze ins genaue Gegenteil umkehrte, bedarf hier ebenso wenig einer Beweisführung wie der Umstand, dass sich somit eine politökonomisch zu verstehende Quellenlage gar nicht widerspruchsfrei auf die „Klassiker“ stützen konnte.
2.
Eine konkrete Rechtsgrundlage, auf deren Basis bis dahin freie Hofeigentümer zum Eintritt in die LPGen hätten bestimmt werden können, gab es freilich nicht.
Geregelt war zwar das Procedere bei dem „Eintritt“ in die LPG oder für die erstmalige Gründung einer LPG durch entsprechend genötigte Bauern. Aber genau diese Verfahrensschritte waren es in ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Konsequenz, die seinerzeit betroffene Landwirte bis heute von einer „Quasi-Enteignung“ sprechen lassen. Die kostenlose Übertragung der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Rahmen der zwingend gebotenen Einbringung hatte zwar keine Änderung im Status als Grundeigentümer zur Folge. Gleichwohl war mit der Einbringung durch die Schaffung des nachfolgenden Nutzungsrechtes der LPGen eine völlige Entkapitalisierung des Bodens verbunden. Die damit zwangsweise einhergehende Einbringung auch allen lebenden und toten Inventares im Rahmen der sogenannten Pflichtinventarbeiträge galt aus staatlicher Sicht zwar als Bildung notwendigen „Startkapitals“ in den LPGen, hatte aber einen noch umfassenderen (eigentumsrechtlichen) Entzugscharakter.
3.
In den Jahrzehnten nach 1960 gab es viele wahrheits- bzw. geschichtsfälschende Rechtfertigungsversuche zu den an den freien Bauern begangenen Repressalien, die von der grundsätzlich geschönten Aussage zu einer insgesamt freiwilligen Erwartungshaltung der Landbevölkerung („De Appel ist riep“) bis hin zur der Behauptung ausuferten, die betroffenen Landwirte konnten doch froh sein, da die Aufnahme in die LPG ihre an sich nicht mehr überlebensfähigen Einzelbetriebe vor dem ökonomischen Aus „rettete“.
Je länger die Geschehnisse des Jahres 1960 zurück lagen, desto größer war die Gefahr, dass sich solche Begründungen unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zementierten. Allerdings hatte ich insoweit das Glück, während meines Landwirtschaftsstudiums auf einige Bauernsöhne als Kommilitonen zu treffen, die mir – wenn auch hinter vorgehaltener Hand – zu großer Skepsis bei der Belastbarkeit der staatlich geprägten Blickweise auf die Historie des „Sozialistischen Frühlings“ rieten.
4.
Die Herstellung der Vollgenossenschaftlichkeit wurde dann zwar als umfassender Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse auf breiter Front auf dem Land gefeiert. Das war zumindest politökonomisch jedoch nicht völlig widerspruchsfrei, da bei den entstandenen LPG-Strukturen – die Älteren werden sich erinnern – in der Auswahlmöglichkeit zur LPG Typ I zwar die Land-Bewirtschaftung weitestgehend kollektiviert war, nicht jedoch die Bewirtschaftung innerhalb der Tierproduktion, die bei den Landwirten „privat“ verblieb. So war eine eigenstände Akkumulation und Konsumtion im Rahmen der Tierproduktion tatsächlich für einige wenige Jahre noch möglich. Aber auch diese – wenn man so will – verbliebene privatbäuerliche Nische wurde Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre verschlossen, als es, in der Methodik ähnlich wie im Vorfeld des „Sozialistischen Frühlings“, darum ging, die Typ-I-Bauern entweder zur Umbildung in eine LPG Typ III oder zu einem dortigen Anschluss zu bestimmen. Die insoweit zur Herstellung einer Art Gleichklang mit den Typ-III-Bauern kreierten „Fondsausgleichsbeiträge“ waren dabei ein Instrumentarium, den Typ-I-Bauern nachträglich den Wirtschaftserfolg der bis dahin verbliebenen privaten Tierproduktion wegzunehmen; eine rechtliche Konstellation im Übrigen, die uns als einer der bestimmenden Schwerpunkte in den rechtlichen Auseinandersetzungen im Rahmen der Privatisierung nach 1990 beschäftigt hat.
5.
Im Hinblick auf die zwangsweise entzogenen Produktionsmittel festigte sich der subjektiv empfundene Enteignungscharakter bei den betroffenen Bauern für den Zeitraum der Existenz der DDR dann vor allem durch zwei Hauptmechanismen, nämlich dem umfassenden und dauernden Nutzungsrecht der LPGen am eingebrachten Boden und der „Zugehörigkeit“ des geleisteten Pflichtinventars und der Fondsausgleichsbeträge am sogenannten „unteilbaren Fonds“ in den LPGen. Das zur Erinnerung; selbst im Ergebnis eines Austrittes aus einer LPG war die Wiederbegründung einer einzelbäuerlichen Bewirtschaftungsweise nicht möglich, da sowohl der Boden als auch der unteilbare Fonds keinen Anteil eines wie auch immer gearteten Auseinandersetzungsanspruches des ausscheidenden Mitgliedes aus der LPG ergaben. Ein ausscheidender Genossenschaftsbauer ging mit „Nichts“. Vielmehr wurde er veranlasst, zu den in der LPG verbliebenen Flächen die enteignungsähnlichen Kreispachtverträge abzuschließen.
An diesem – vor allem vermögens- und eigentumsrechtlichen – Status der in die LPGen gezwungenen Landwirte änderte sich dann bis 1990 nichts, weil sonstige strukturelle Veränderungen in der Landwirtschaftspolitik – z.B. Trennung in LPGen mit Tier- und Pflanzenproduktion – an dem vorgenannten Nutzungsrecht und der Unteilbarkeit der genossenschaftlichen Fonds nichts änderten.
6.
Für viele der im Jahr 1960 von der Zwangskollektivierung betroffenen Betriebsinhaber kam einer der glücklichsten Momente der deutschen Geschichte, nämlich die politische Wende mit der Wiedervereinigung in den Jahren 1989/90 nach zwischenzeitlich vergangenen 30 Jahren zu spät. Entweder waren sie nicht mehr am Leben oder nicht mehr jung genug, um den durch die nunmehr anstehende Reprivatisierung der ostdeutschen Landwirtschaft gebotenen Möglichkeiten zur Wiedereinrichtung ihrer Betriebe nachzukommen. Wohl denen, die die Zwangskollektivierung noch in jungen Jahren getroffen hatte und sie selbst einen Neuanfang starten konnten bzw. gut für die, die in der ersten oder auch schon zweiten Nachfolgegeneration tatkräftige junge Männer und Frauen hatten, die anstelle der Eltern oder Großeltern den Neustart begannen. Das war gerade in letzterer Konsequenz keine Selbstverständlichkeit. Denn viele der von der Zwangskollektivierung betroffenen Bauern ließen ihre Kinder oder Enkel zu DDR-Zeiten gerade keinen landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf ergreifen, weil sie ihnen den damit verbundenen verpflichtenden Gang in LPG oder VEG ersparen wollten.
Ein durchaus bestimmender Punkt einer agrarstrukturellen Betrachtung der Folgen des „Sozialistischen Frühlings“, wenn man nach 1990 rekapitulieren musste, dass die Wiedereinrichtung eines bäuerlichen Landwirtschaftsbetriebes daran scheiterte, dass ein entsprechender „Hofnachfolger“ gar nicht zur Verfügung stand. Nicht alle vom Alter her in Frage Kommenden aus der Nachfolgegeneration hatten außerdem den Mut, sich beruflich völlig umzuorientieren, weshalb manche vom „Sozialistischen Frühling“ und seinen Folgen betroffene Bauern bzw. ihre Kinder die weitere (eigene) Tätigkeit in der Landwirtschaft in den betrieblichen Nachfolgestrukturen der LPGen nach 1990 suchten. Die diesbezügliche Konsequenz ist aus meiner Sicht Gegenstand einer wertungsfreien Betrachtung, obwohl gegen die Entscheidung eines beruflichen Neustartes als Wiedereinrichter neben einer möglicherweise fehlenden Generationsnachfolge auch mannigfaltige andere Aspekte – gebietsweise sehr unterschiedlich – hinzukommen konnten. Gemeint sind die finanziellen Risiken einer Wiedereinrichtung, die fehlende Möglichkeit zur Schaffung aktuell überlebensfähiger Bewirtschaftungsstrukturen (Stichwort: Flächenbestand) bis hin zu familiärem und/oder dörflichem Druck, sich doch lieber dem Nachfolgebetrieb der LPG anzuschließen.
7.
So war es und ist es nach 1990 eine weitere agrarstrukturelle Folge der Entwicklungen, die durch den „Sozialistischen Frühling“ gesetzt wurden, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine große Vielfalt von landwirtschaftlichen Betriebsformen entstand. Historisch unbestreitbar ist es dabei, dass – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung in den ostdeutschen Bundesländern – in durchaus beherrschender Anzahl Betriebsstrukturen in Form von Agrargenossenschaften bzw. Agrar GmbH verblieben bzw. neu entstanden, die einem möglichen Leitbild bäuerlicher Landwirtschaft in einer Struktur von Einzel- oder Mehrfamilienbetrieben nicht entsprechen.
Begleitet wurde der Reprivatisierungs- bzw. Umstrukturierungsprozess in der ostdeutschen Landwirtschaft vor allem in den 90er Jahren von vielfältigen Rechtsstreitigkeiten vor allem der ehemaligen LPG-Mitglieder, die ihr Vermögen bzw. ihre Vermögensanteile an den LPGen einforderten, unabhängig davon, ob sie Wiedereinrichter oder Anteilseigner in der Nachfolgeeinrichtung der LPGen wurden bzw. ganz aus der Landwirtschaft ausschieden. Die auf Grundlage des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes geführten Auseinandersetzungen hinterlassen bis heute unterschiedliche Würdigungen zur Umsetzung von Recht und Gerechtigkeit bei der Privatisierung. Dies betrifft auch und vor allem den seinerzeitigen Bedarf an einer zumindest subjektiven Wiedergutmachung der enteignungsgleichen Vorgänge aus dem „Sozialistischen Frühling“ bzw. den späteren Zwangsaktionen gegenüber damaligen Typ-I-Bauern zum Übertritt in die LPG Typ III. Als wiederum sowohl agrarstrukturelle als auch rechtshistorische Folge des „Sozialistischen Frühlings“ muss sich daher auch im Ergebnis der Reprivatisierung zusammenfassen lassen, dass eine für die Wiedereinrichter wirklich gleichwertige Startmöglichkeit durch Rückgabe eingebrachten Vermögens und Teilhabe an der Wertschöpfung aus diesem Vermögen aus DDR-Zeiten jedenfalls flächendeckend nicht gesichert werden konnte. Ich gehöre dabei nicht zu denen, die die Umsetzung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes als Erfolgsgeschichte einordnen.
8.
Für mich durchaus unerwartet haben wir es im Übrigen in den aktuellen Diskussionen um eine wünschenswerte und/oder geeignete Agrarstruktur im Osten Deutschlands mit einer relativ neuen Entwicklungstendenz zu tun, die zwar keine unmittelbare Folge mehr aus dem „Sozialistischen Frühling“ sein kann, aber historisch gesehen freilich nicht auftreten würde, wenn es den „Sozialistischen Frühling“ mit der Entstehung der damaligen LPGen nicht gegeben hätte.
Einige Stimmen bezeichnen das bereits als eine erneute Form der Mitgliederverdrängung. Gemeint sind solche Fälle, in denen Rechtsnachfolger von LPGen – egal, ob als GmbH oder als Agrargenossenschaft – heute aus wie auch immer gearteten Gründen die Betriebe im Rahmen der sogenannten „Share-Deals“ an bislang Betriebsfremde veräußern, sei es an landwirtschaftliche oder an außerlandwirtschaftliche Investoren, wobei ich zu diesem agrarstrukturell aktuellem Veräußerungsgeschehen hier aus Zeitgründen nicht Stellung nehmen will. Mir geht es vielmehr um Erscheinungen, bei denen an verbürgten Einzelfällen eine Entwicklung in den Betrieben stattgefunden hat, in deren Folge vor allem Genossenschaftsmitglieder aber auch Altgesellschafter nach und nach ihr betriebliches Engagement beendet haben, was ja speziell in den Genossenschaften vermögenstechnisch damit verbunden ist, dass ein Genossenschaftsmitglied lediglich das dem ursprünglich eingebrachten Genossenschaftsanteil entsprechende Geschäftsguthaben erhält. An der sonstigen Wertschöpfung am genossenschaftlichen Vermögen nimmt das Mitglied – mangels regelmäßig fehlender entsprechender Zusatzregelung in der Satzung – nicht teil. Wird die Genossenschaft Jahre danach veräußert, erhalten die „verbliebenen“ Genossenschaftsmitglieder im Rahmen der Kaufpreiszuordnung neben ihrer Geschäftsguthaben dann natürlich auch solche Anteile aus dem Kaufpreis, der sich aus der bisherigen Wertschöpfung in den vergangenen 30 Jahren ergeben hat. Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber den zuvor ausgeschiedenen Beteiligten, der in den verbürgten Fällen 5- bis 6-stellige Wertrelationen erreichen kann. Eine hierfür aus Gerechtigkeitserwägungen strukturierte Antwort ist bislang nicht gefunden, vor allem nicht in den Fällen, in denen das „Ausscheiden“ der Altmitglieder/Altgesellschafter an Zeitpunkten erfolgten, zu denen unter Verjährungsgesichtspunkten eine Korrektur des Auseinandersetzungsguthabens nicht mehr beansprucht werden kann.
9.
Zum Fazit im gesamthistorischen Kontext.
Der zur Herstellung der Vollgenossenschaftlichkeit ausgeübte Druck war, da bereits ohne normative Grundlage organisiert, staatliches Unrecht. Die rechtliche Behandlung der von den Landwirten eingebrachten Vermögenspositionen entsprach zwar in Grundlagen damaligen Gesetzen und Statuten, hatte aber – wenn auch in damals gesellschaftskonformer Ausprägung – faktisch enteignungsgleichen Charakter. Das waren die Vorzeichen für die Entwicklung, die mindestens zwei Generationen des Bauernstandes in Ostdeutschland keine Möglichkeit bot, in selbständiger Entscheidung ihr Schicksal als freier Landwirt auf eigener Scholle mit allen Vorteilen – aber auch Risiken – zu gestalten.
Nicht für jede bäuerliche Familie konnte bzw. sollte sich dies nach 1990 so restrukturieren lassen, dass daraus die Wiederherstellung einer bäuerlichen Selbständigkeit als eigenverantwortlicher betrieblicher Unternehmer auch unter den neuen wirtschaftlichen Gesichtspunkten resultierte. Umso wichtiger ist es, durch moderne landwirtschaftliche Struktur- und Förderpolitik die Rahmenbedingungen für die betrieblich wieder entstandenen Strukturen jenseits der Genossenschaften bzw. Kapitalgesellschaften so zu organisieren, dass im Betriebsvergleich mindestens Chancengleichheit gewährleistet ist.
So sollten wir unseren Gedenktag und dessen Begehung auch als Signal an alle Verantwortlichen in Erster und Zweiter Gewalt verstehen, aus der Erinnerung des staatlichen und wirtschaftlichen Unrechts des „Sozialistischen Frühlings“ die notwendigen Lehren zu ziehen. Zwar gehen wir davon aus, dass sich – Gott lob – ein solch enteignender Schlag gegen die Bauernschaft nie wiederholt. Vorstellbar ist allerdings, dass sich durch künftige Entwicklungen Tendenzen verfestigen, die letztlich in ihrer wirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Ausprägung dazu führen, dem bäuerlichen Stand der Einzel- und Familienbetriebe die erforderliche Bedeutung in der wünschenswerten und notwendigen Breite zu nehmen.
Den Opfern und den Folgen des „Sozialistischen Frühlings“ zu gedenken, verlangt dann gleichzeitig, vor solchen Tendenzen zu warnen und ihnen aktiv und geschlossen entgegenzutreten.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.